02/07/2024 0 Kommentare
Worte für den Tag im Rundfunk von Beate Hornschuh-Böhm: Februar 2018
Worte für den Tag im Rundfunk von Beate Hornschuh-Böhm: Februar 2018
# Rundfunkandachten/Videos der Superintendentin

Worte für den Tag im Rundfunk von Beate Hornschuh-Böhm: Februar 2018
Auf dieser Seite finden Sie Rundfunkandachten von Superintendentin Beate Hornschuh-Böhm.
(Foto: martin.bahr[at]piqx.de)
Andachten für die Woche vom 19. bis 24. Februar 2018
Worte für den Tag - Worte auf den Weg (rbb)
von Beate Hornschuh-Böhm
Samstag, 24. Februar 2018
Eine Journalistin berichtet, wie sie neulich in einer abgelegenen brandenburgischen Pension versucht hat, über das einzig verfügbare Festnetztelefon Hilfe zu erreichen. Ihr war bei der Anreise der Rucksack mit Portemonnaie, Handy und allen wichtigen Papieren gestohlen worden. Sie wählt sich die Finger wund, fragt sich durch, wird verwiesen, wählt noch einmal, wird wieder verwiesen. Schließlich muss sie in ihrer weit entfernten Heimatstadt anrufen, um endlich jemanden zu finden, der ihr die Adresse einer Berliner Polizeiwache geben kann. Für sie ist das Ganze ein frustrierendes Lehrstück lähmender Gleichgültigkeit und Empathielosigkeit.
Ja, die Beispiele lassen sich mühelos fortsetzen. Im Foyer einer Bank stirbt ein Mann an Herzversagen, weil die hereinkommenden Leute zwar ihr Geld abheben, aber nicht den Notruf wählen. Ein Schwarzer wird abends in der U-Bahn von Jugendlichen angepöbelt, doch die anderen Fahrgäste schauen weg. Woher kommt nur diese furchtbare Gleichgültigkeit, fragt die Journalistin, „ist es Resignation vor zu vielen Problemen?“ Abstumpfung angesichts der endlosen Leiden, die das Fernsehen täglich ins Wohnzimmer bringt? Hilflosigkeit? Ohnmacht?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass diese Egal-Mentalität nichts Neues ist. Von ihr erzählt schon der Evangelist Lukas in seiner Geschichte vom barmherzigen Samariter, diesem empathischen Ausländer. Der war der einzige, der sich um den Verletzten am Straßenrand gekümmert hat, während alle anderen achtlos an ihm vorbeigingen.
Und ich weiß auch, dass es auch die anderen Geschichten gibt. Von den Ärzten zum Beispiel, die sich nach ihrer Schicht im Krankenhaus noch Zeit nehmen, um Obdachlose in Berlin zu versorgen – unentgeltlich. Oder von den jungen Leuten, die ehrenamtlich Fußballturniere organisieren zwischen Einheimischen und Flüchtlingen, wo jeder die Chance hat, einmal Sieger zu sein.
Mitgefühl ist nichts Selbstverständliches. „Mitgefühl“, schreibt der Autor Jonathan Safran Foer, „ist ein Muskel, der mit dem Gebrauch stärker wird, und wenn wir regelmäßig trainieren, uns für Freundlichkeit statt Gleichgültigkeit entscheiden, dann werden wir uns verändern.“ Ich glaube, dass das tatsächlich geht. Und nirgendwo lässt sich Empathie besser trainieren als in unserem Alltag.
Zitat: Jonathan Safran Foer, Tiere essen, Frankfurt 2013, S. 296
Freitag, 23. Februar 2018
Es geht wieder einmal hektisch zu in der Küche von Lamotte-Beuvron. Eine Jagdgesellschaft hat sich zum Essen angekündigt, und Stéphanie, zuständig für Süßspeisen und Gebäck, will rasch noch einen Apfelkuchen backen. Doch in der Eile bemerkt sie nicht, dass sich in der Backform, in die sie schon die Äpfel gefüllt hat, kein Teig befindet. Was also tun? Die Gäste sind hungrig, der Chef ist streng und ihr guter Ruf steht auf dem Spiel. Da kommt ihr die rettende Idee. Sie legt den Teig über die Äpfel und schiebt die Backform in den Ofen. Am Ende dreht sie das Ganze einfach um. Das Ergebnis ist phantastisch. Die weltberühmte Tarte Tatin ist erfunden.
Fehler zu machen ist unangenehm. Sie einzugestehen noch viel mehr. Schon von klein auf lernen wir, Fehler zu vermeiden. Beim Diktat in der Schule, bei der Prüfung in der Ausbildung, bei unseren Entscheidungen fürs Leben. Dabei passieren Fehler jeden Tag und überall. Ein Termin wird verpasst, eine Diagnose falsch gestellt, ein Examen nicht bestanden, die Beziehung geht in die Brüche. Fehler zu machen ist kein peinliches Versagen. Es ist völlig normal.
Und Fehler bringen uns meistens sogar voran. Ohne sie gibt es keinen Erkenntnisfortschritt. Das setzt sich inzwischen auch in den Chefetagen großer Firmen durch. Waren Fehlermeldungen im Geschäftsalltag bisher oft angstbesetzt und tabuisiert, verleihen manche Unternehmen inzwischen Preise für den „Fehler des Monats“. Oder sie gründen Start-ups eigens zu dem Zweck, die Betriebsabläufe von außen auf Schwachstellen zu überprüfen. Mit einem überraschenden Ziel: Gefragt wird nicht mehr, wer etwas falsch gemacht hat, sondern was aus Fehlern zu lernen ist. Kein Wunder, dass in puncto Fehlerkultur ausgerechnet Familienunternehmen am fortschrittlichsten sind. Aus dem gegenseitigen Grundvertrauen heraus wird nicht nach einem Schuldigen gesucht, sondern gemeinsam überlegt, wie man es künftig besser machen kann.
Fehler gehören zu unserem Menschsein. Sie sind vielleicht das Beste und das Spannendste an uns. Und FEHLER sind HELFER. Beide Worte haben die gleichen Buchstaben, nur in anderer Reihenfolge. Stehen wir also zu unseren Fehlern! Denken wir daran, dass immer wieder auch etwas so Wunderbares aus ihnen entstehen kann wie eine Tarte Tatin.
Donnerstag, 22. Februar 2018
Bei einem Auftritt erzählte der Kabarettist Steffen Köhler folgende Begebenheit. Er sitzt morgens um sieben Uhr im Speisewagen des Eurocity Berlin-Warschau. Der polnische Kellner wünscht ihm fröhlich einen guten Tag. Der Fahrgast hat um diese frühe Stunde aber keine Lust auf ein tiefschürfendes Gespräch. Also beschränkt er sich auf ein schlichtes: „Wie geht’s?“ Die rhetorische Frage hat eine ungeahnte Wirkung. Das eben noch strahlende Gesicht des Kellners verwandelt sich in ein Bild des Jammers, er seufzt: „Ach, wie schon, das alte Elend!“ Hierzulande, erläutert Steffen Köhler, erwartet man auf die Allerweltsfrage ein routiniertes „gut“ oder „alles okay, danke der Nachfrage.“ Und das auch dann, wenn das nicht der Wahrheit entspricht. In Polen ist das anders. Fragt dort jemand nach meinem Befinden, möchte er eine aufrichtige Antwort hören. Das Keep-smiling-Prinzip hat sich bei unseren polnischen Nachbarn zum Glück noch nicht durchgesetzt.
Wir sind daran gewöhnt, beherrscht zu bleiben und Haltung zu bewahren. In einer Gesellschaft der Selbstoptimierer kommen Leute, die Schwäche zeigen, nicht gut an. Bloß nicht auffallen. Bloß niemandem zur Last zu fallen! Wer sich nicht daran hält, kommt schnell als Jammerlappen rüber, der anderen auf die Nerven geht.
Diese beherrschte Haltung hat aber auch eine Schattenseite. Wer immer nur im Verborgenen leidet und seinen Kummer unter Verschluss hält, macht es seinen Mitmenschen schwer, Anteil zu nehmen. Da ist die einsame Freundin, die sich vor Kurzem von ihrem Mann getrennt hat, alle Nachfragen aber mit der knappen Formel abwehrt: „Ich komme schon zurecht.“ Oder der Kollege, der sich aufreibt zwischen Arbeit und Familienpflichten, jedes Angebot zur Unterstützung aber zurückweist aus Angst, nicht mehr als Leistungsträger zu gelten.
Kummer und Sorge brauchen eine klare Sprache, um wahrgenommen zu werden: „Gott, wie lange muss ich noch Leid in meinem Herzen tragen und mich um mein Leben sorgen? Schau doch her und sieh mich an!“ klagt der Beter in den Psalmen. Eine klare und ehrliche Ansage. Trauen auch wir uns ehrlich zu sein. Die Psalmen geben uns dafür eine Sprache und unsere polnischen Nachbarn machen es uns vor.
Mittwoch, 21. Februar 2018
Unscheinbar sieht es aus, das kleine Fischerboot neben dem Schwanenteich in Wittenberg. Fast schon zerbrechlich. Die weiße Farbe blättert ab, der Rahmen aus Eisen rostet vor sich hin, und durch die hölzernen Wände ziehen sich tiefe Risse. Was aber am meisten ins Auge fällt, ist ein leuchtend roter Schriftzug ganz vorne am Bug. „Amal“, steht da in arabischen Buchstaben, das bedeutet „Hoffnung.“ Auf Deutsch.
Die Informationstafel neben dem Boot gibt Auskunft. Es handelt sich um ein Flüchtlingsboot, das im letzten Sommer zur Weltausstellung von Lampedusa nach Wittenberg gebracht wurde. 240 Menschen, so lese ich, haben in diesem Boot das Mittelmeer überquert und nach vierzehn Tagen und Nächten unversehrt die italienische Küste erreicht.
Unvorstellbar! 240 Männer, Frauen und Kinder harren dicht gedrängt zwei Wochen aus auf diesem winzigen Schiff. Bei Wind und Wellen, bei Hitze am Tag und Kälte in der Nacht. Wie groß muss ihre Sehnsucht gewesen sein nach einem Leben ohne Elend und Gewalt, dass sie diese lebensgefährliche Fahrt gewagt haben. Und wie übermächtig ihre Hoffnung auf ein gutes Ende, dass sie ihrem zerbrechlichen Kahn so einen wunderbaren Namen gaben: „Hoffnung“. Wie mag es ihnen ergangen sein in den langen Tagen der Überfahrt? Was haben sie gemacht, wenn die Hoffnung schwand und die Angst kam und der Zweifel, jemals das rettende Ufer zu erreichen? Haben sie gesungen oder gebetet, geschrien oder einander Mut gemacht? Haben sie um Trinkwasser gestritten oder alles geteilt? Wer hat die Ängstlichen beruhigt?
Von all dem steht nichts auf der nüchternen Hinweistafel neben dem Boot.
Für den südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela war es ein Gedanke, der ihn in den langen Jahren seiner Gefangenschaft nicht den Mut verlieren ließ: Ich bin der Kapitän meiner Seele. Den Weg, den mein Leben nimmt, kann ich nicht immer beeinflussen. Aber die Richtung, in die meine Seele steuert, bestimme ich selbst. Ich entscheide mich für Resignation oder Hoffnung. Die Hoffnung richtet den Blick nach vorne und öffnet ihn ins Weite. Sie ist eine vertrauensvolle Einstellung dem Leben gegenüber. Ein Zeichen dieses Vertrauens bleibt das kleine Schiff mit dem großen Namen: Amal – Hoffnung. 240 Menschen hat es getragen, über’s offene Meer und am Ende sicher zum Ziel.
Dienstag, 20. Februar 2018
Mittagspause während der Konferenz. Von der Kirche in der Nähe läuten die Glocken zwölf Uhr. Mein Blick fällt aus dem Fenster des Sitzungssaales auf das Gelände der Speditionsfirma gegenüber. Auch dort ist jetzt Pause. Die Angestellten stehen in kleinen Gruppen beieinander, nippen an großen Kaffeebechern oder beißen in Sandwiches. Sie lachen, rauchen und halten ihr Gesicht in die erste Frühlingssonne. Etwas abseits entdecke ich zwei Männer mit gestickten Käppchen auf dem Kopf. Sie verneigen sich, knien nieder auf einem Stück Teppich, beugen sich tief zum Boden und erheben sich wieder. Zwei Muslime beim Gebet, ganz versunken in das Ritual, ohne sich von den schwatzenden Kollegen und dem Lärm der Lastwagen um sie herum stören zu lassen.
Ihr Anblick beeindruckt mich. Würde ich mich auch trauen, so selbstverständlich und freimütig meinen Glauben in der Öffentlichkeit zu zeigen? Nur zu gut kenne ich den kurzen Augenblick der Verlegenheit, wenn ich vor dem Essen in der Kantine die Hände zu einem stillen Tischgebet falte. Und höchst ungern erinnere ich mich an die Zugfahrt, bei der mein Sitznachbar den Kirchentags-Anstecker an meinem Rucksack entdeckte und sofort seinen ganzen Groll über kirchliche Missbrauchsskandale, fundamentalistische Wahrheitsfanatiker und bischöfliche Geldverschwendung über mir ausgoss. Er gab mir keine Chance auf einen sachlichen Austausch. Religion im Allgemeinen und Kirche im Besonderen waren für ihn ein einziges Übel. Da dachte ich hinterher: Muss ich mir das noch einmal zumuten? Sollte ich den Kirchentags-Anstecker künftig lieber in der Tasche lassen?
Die beiden Muslime sind immer noch ganz in ihr Gebet vertieft. Ich frage mich: Wie oft sind sie wohl schon haftbar gemacht worden für die Schattenseiten ihrer Religion, für islamistische Terrorangriffe, für Todesurteile im Namen der Scharia und für die mangelnde Gleichberechtigung von Frauen? Und doch lassen sie sich nicht darin beirren, ihren Glauben zu zeigen, ohne Scheu und ohne ihn zur Schau zu stellen. Sie leben ihn in einem beständigen Rhythmus, mit seinen Regeln und Ritualen. Sie geben ihm eine sichtbare Form, die ihren Alltag gestaltet.
Die Glocken sind verstummt. Die Mittagspause ist zu Ende, der Gebetsteppich eingerollt. Und mein Kirchentags-Anstecker, der bleibt draußen am Rucksack.
Montag, 19. Februar 2018
Ein Aufschrei ging damals durch die Stadt Zürich. Im Jahr 1522, mitten in der Fastenzeit, lädt der Buchdrucker Christoph Froschauer ein paar Freunde zum deftigen Wurstessen ein. In der Bibel, so begründet er seine Aktion, steht nirgendwo geschrieben, was man in den sieben Wochen vor Ostern essen und trinken darf und was nicht. Von der Kanzel des Großmünsters pflichtet ihm der Reformator Huldrych Zwingli bei. In der Fastenzeit ginge es darum, sich auf die 40 Tage zu besinnen, die Jesus damals in der Wüste verbracht hat. In welcher Weise das ein Christ tut, steht jedem frei. Wenn er dabei Bier trinken und Wurst essen will, kann er das machen, ohne sich verstecken zu müssen. Es kommt zu Tumulten in Zürich. Und Froschauer muss sich am Ende für seine Wurstaktion vor dem Stadtrat verantworten.
Das alles ist 500 Jahre her. Heute ist der ausgiebige Genuss von Wurst und Fleisch weniger aus religiösen als vielmehr aus gesundheitlichen und ethischen Gründen in die Kritik geraten. Die einen verzichten auf Fleisch wegen der üblichen Beimischung von Antibiotika und Hormonen in der industriellen Fleischproduktion. Andere wiederum möchten mit ihrem Fleischkonsum nicht dazu beitragen, dass immer mehr Ackerflächen für den Anbau von Futtermitteln genutzt werden anstatt für Obst und Gemüse. Sie verweisen auf die schädlichen Folgen für die Felder und Weiden und das Grundwasser. Der Verzicht auf Fleisch ist mittlerweile Ausdruck eines bewussten Lebensstils geworden. Kein Restaurant ohne ein reichhaltiges Angebot an vegetarischen Gerichten, kein Kochbuch ohne vegane Rezepte. Und grüne Smoothies gehören in jedes moderne Bistro.
Aber schon Zwingli betonte in seiner Züricher Fastenpredigt, dass nicht die Speisen an sich gut oder schlecht sind. Es ist vielmehr ihr Missbrauch, der Schaden anrichtet – und die Maßlosigkeit. Das geschieht, wenn der verschwenderische Konsum der einen zum Mangel für die anderen wird. Im wachsamen Umgang mit den Lebensmitteln und Gütern der Erde zeigt sich, welche Beziehung wir zu Gott, dem Schöpfer haben, zum Nächsten und zu uns selbst. „Zeig dich“, heißt daher das Motto der diesjährigen Fastenaktion der evangelischen Kirche. Zeig, was du brauchst und wofür du stehst! Und das nicht nur beim Essen und Trinken.
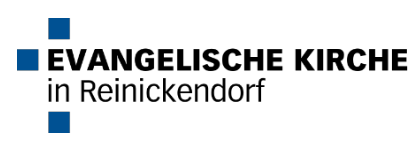

Kommentare