02/07/2024 0 Kommentare
Worte für den Tag im Rundfunk von Beate Hornschuh-Böhm: April 2017
Worte für den Tag im Rundfunk von Beate Hornschuh-Böhm: April 2017
# Rundfunkandachten/Videos der Superintendentin

Worte für den Tag im Rundfunk von Beate Hornschuh-Böhm: April 2017
Auf dieser Seite finden Sie Rundfunkandachten von Superintendentin Beate Hornschuh-Böhm.
(Foto: martin.bahr[at]piqx.de)
Andachten für die Woche vom 18. bis 22. April 2017
Worte für den Tag - Worte auf den Weg (rbb)
von Beate Hornschuh-Böhm
Samstag, 22. April 2017
Im April hat Lenas Großmutter Geburtstag. Die neunjährige Enkelin will ihr eine Geschichte schenken, selbst ausgedacht und aufgeschrieben und mit bunten Zeichnungen geschmückt. Von einem kleinen Igel soll sie handeln, der im Sommer im Garten wohnt und dann im Spätherbst in einen warmen Laubhaufen kriecht. Und dort drinnen denkt er, kurz bevor er in den Winterschlaf fällt: „Ich freue mich schon auf die Frühlingssonne, die mich wieder weckt.“ Kaum ist Lena fertig, kommen ihr Zweifel. Jetzt hat sie eine Geschichte vom Herbst geschrieben, aber die Großmutter hat doch im Frühling Geburtstag. Ob es ihr trotzdem gefällt? Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten und erschreckt Lena zuerst: „Liebe Lena,“ schreibt das Geburtstagskind, „du hast doch ganz recht, mir eine Geschichte vom Herbst zu schenken. Mit meinen 72 Jahren bin ich längst im Herbst meines Lebens angekommen. Und auch ich stelle mir vor, dass ich eines Tages wie der kleine Igel unter der Erde liege und Laub auf mich fällt. Und dann freue ich mich auf den Tag, an dem mich Gott zu einem neuen Leben aufweckt.“
Was Lena noch nicht wissen kann: das Frühlingserwachen ist von jeher ein Bild für die Auferstehung. In fast allen Kulturen der Welt wird das Leben im Kreislauf von Werden und Vergehen beschrieben. Der Rhythmus von Winterruhe und Frühlingssonne, von Knospen und Blüten, Säen und Ernten spricht von der tiefen menschlichen Sehnsucht nach Aufbruch und Neuanfang. In alten Klosteranlagen wurden die Toten daher oft in der Nähe von Obstbäumen bestattet, an deren Wechsel durchs Jahr man sehen konnte, was mit denen geschieht, die gestorben sind.
Doch die Auferweckung der Toten geht noch weit darüber hinaus. Sie ist eine Sensation, die alle Vergleiche mit der Natur sprengt. Lenas kleiner Igel wird irgendwann an einem Frühlingsmorgen aufwachen und sein Leben dort fortsetzen, wo es der Winterschlaf unterbrochen hat. Wir aber müssen nicht in der Endlosschleife eines ewigen Kreislaufs hängen bleiben. Wenn das alte Leben vergeht, wird es verwandelt in etwas ganz Neues. Martin Luther hat dafür ein schönes Bild gefunden: „Sobald uns die Augen zufallen und wir ins Grab gelegt werden, werden wir wieder auferweckt. Denn tausend Jahre sind, als hätten wir nur eine halbe Stunde geschlafen. Ehe sich einer recht umsieht, wird er ein schöner Engel sein.“
Freitag, 21. April 2017
Etwas Neues kann nur beginnen, wenn vorher das Alte vergeht. Loslassen gehört daher zur Kunst des Lebens. Davon erzählt eine leise Ostergeschichte aus dem Johannesevangelium.
Für Maria Magdalena fängt der Ostertag düster an. Im Morgengrauen irrt sie auf dem Friedhof umher. Eingeschlossen in ihren Kummer und vor Tränen blind will sie wenigstens in der Nähe des toten Jesus sein und ihn durch ihre Liebe lebendig halten. Tot ist doch nur, wer vergessen wird, denkt sie trotzig und ahnt wohl gar nicht, wie viele Tote wir auf dem Gewissen hätten, wenn dieser Spruch wirklich stimmte. Ziellos wandert ihr Blick zum Grab, das seltsam offensteht. Zwei lichte Engelgestalten sprechen sie an: „Warum weinst du?“
Was für eine dumme Frage! Wahrscheinlich können sich Engel nicht vorstellen, wie traurig es ist, in einer Welt zu leben, in der ein Mensch hingerichtet wird, weil er Gottes Liebe mehr gehorcht als den Ordnungen der Machthaber. Und dass jetzt, wo er tot ist, eine Welt zurückbleibt, die ohne Gott auskommen muss. Wenn das nicht zum Heulen ist!
Hilflos wendet sich Maria Magdalena ab. Und sieht im Dämmerlicht noch jemand Anderen dastehen. Den Gärtner womöglich? Ob er vielleicht etwas weiß über den Verbleib des Leichnams? Sie muss ihn doch finden. Sie braucht einen Ort, an dem sie in Erinnerungen schwelgen und in der Vergangenheit versinken kann. Gerade jetzt, wo sich so viel ändert und so viel Neues auf sie einstürmt. Ob der Gärtner ihr beim Suchen behilflich sein könnte?
Der Gärtner ist immer der Schöpfer. In der Bibel jedenfalls. Das weiß man seit Beginn der Welt im Garten Eden. Wo der schöpferische Gärtner erscheint, wird es lebendig. Denn er ruft sie alle beim Namen: die Bäume und Pflanzen, die Planeten und Meere, die Tiere und Menschen. Wie auch jetzt der aufs Neue lebendige Jesus die todtraurige Maria bei ihrem Namen nennt: „Maria!“
Sie hört den Weckruf, der sie aus der Erstarrung löst. Schon kommt Bewegung in ihre Beine. Sie will auf ihn zu stürzen. Doch Jesus wehrt ab: „Halte mich nicht fest!“ Die Zeit lässt sich nicht anhalten oder zurückdrehen. Er wird nie wieder leibhaftig ein Jesus zum Anfassen sein. Und doch flirrt fortan die Luft von seiner Gegenwart. Und er ist da, so wirklich wie der Gärtner.
Donnerstag, 20. April 2017
Bei Majestätsbeleidigung hört der Spaß auf. Egal, ob es sich um Karikaturen zu Religionsstiftern oder um die freche Satire auf ein Staatsoberhaupt handelt. Wer sich darüber aufregt, tut das, weil er um die Macht weiß, die in einem Lachen steckt: Wer sich lustig macht über angemaßte Erhabenheit, der schafft eine Distanz zu den Autoritäten und reduziert ihre vermeintliche Größe auf ein lächerliches Maß.
Das wusste man auch schon in der Bibel. Zwar wird in den Evangelien nicht ausdrücklich erwähnt, dass Jesus selbst viel gelacht oder in Gesellschaft Witze gerissen hätte. Aber es wird erzählt, dass er sich gerne dort aufgehalten hat, wo das Lachen zu Hause war, bei Hochzeiten und anderen ausgelassenen Festen. Für ihn war sogar das ganze Leben nichts anderes als ein großes Fest, das es zu feiern gilt aus Freude an Gott.
Vor allem Ostern erinnert uns daran, dass wir allen Grund zum fröhlichen Lachen haben. Weil nicht dem Tod das letzte Wort zukommt, sondern dem Leben. Darin liegt der innerste Kern des christlichen Glaubens. Der Evangelist Matthäus erzählt seine Ostergeschichte darum auch mit herrlichem Humor.
Nachdem Jesus hingerichtet und begraben war, wurde einem Trupp Soldaten befohlen, das Grab des Toten strengstens zu bewachen. Aber weshalb? Hatten die Machthaber etwa Angst, dieser Jesus könnte ihnen sogar noch als Leiche gefährlich werden? Oder fürchteten sie, dass der, der sich ständig ihrer Ordnung widersetzt hatte, auch im Tod nicht zu bändigen ist? Wie auch immer. Sicher ist sicher. Und so stehen diese Wachleute nun bis an die Zähne bewaffnet vor dem verschlossenen Grab. Doch in der Frühe des Ostermorgens fährt ein Engel vom Himmel herab und die Erde erbebt in ihren Grundfesten. Die Wachsoldaten stürzen wie tot zu Boden, während der Tote sich aus dem Grab erhebt.
Man kann sich lebhaft vorstellen, wie diese groteske Satire in den jungen, verfolgten Christengemeinden die Runde machte. Und man wird das gelöste Lachen hören, mit dem die Bedrängten alle Lähmung und Furcht vor den brutalen Machthabern abschüttelten. Lachen, das spürten sie, ist eine Trotzmacht gegen die Angst. Es macht frei und stark. Wer aber keine Angst hat, ist nicht mehr beherrschbar. Das gilt überall. Alle Menschen lachen in derselben Sprache.
Mittwoch, 19. April 2017
Die Ansichtskarte steckt an meiner Kühlschranktür. Freunde haben sie mir geschickt aus ihrem Urlaub in Finnland. Darauf ist das Altarbild einer kleinen Stadtkirche zu sehen. Es ist vielleicht kein bedeutendes Kunstwerk, aber doch ein ungewöhnliches Osterbild. Es zeigt ein einzelnes Kreuz, das Kreuz von Golgatha. Scheinbar achtlos hingeworfen flattert von diesem Kreuz herab ein großes weißes Leinentuch, wohl jenes Grabtuch, in das nach den Ostergeschichten der Evangelien der Leichnam Jesu eingehüllt war. Niemand ist auf dem Bild zu sehen. Es gibt nur dieses leere Kreuz und das eilig zurück gelassene Leinentuch.
Der Künstler hat ein Osterbild gemalt, aber kein Abbild des Auferstandenen. Vielleicht, überlege ich, ist es ihm dabei auch um die Frage gegangen, die manche Menschen umtreibt, wenn sie einen geliebten Angehörigen verloren haben: „Werden wir uns wiedersehen? Und auch wiedererkennen?“
„Wie sieht ein Auferstandener aus?“ Das wollten schon die Christen der ersten Generation vom Apostel Paulus wissen. „Wie sehen wir einmal aus, wenn wir nach dem Tod auferstehen? Sind wir dann noch Menschen? Verschwinden die Spuren des Erdenlebens oder nehmen wir sie mit in die neue Welt Gottes?“
In einem langen Brief versucht der Apostel, darauf eine Antwort zu geben. Er vergleicht die Auferstehung mit einem Vorgang in der Natur: „Wenn du ein Samenkorn säst, wird es nicht lebendig, wenn es nicht vorher gestorben ist. Und was du säst, ist auch nicht das Lebewesen, das daraus entsteht.“ Vermutlich war das noch nicht die Auskunft, die die wissbegierigen Fragesteller von ihm erwartet hatten. Aber auch der kluge Paulus weiß zum Aussehen der Auferstehungskörper nicht mehr zu sagen. Niemand kann wirklich wissen, wie ein Auferstandener aussieht. Alle Antworten darauf bleiben Spekulation. Nur in einem ist sich der Apostel sicher: Das alte Leben vergeht. Und es wird verwandelt in ein neues. Gottes schöpferische Energie durchzieht unermüdlich die Welt, um neues Leben zu schaffen. Wenn jemand wissen will, was Auferstehung bedeutet, dann sehe er sich nur um. Es ist wie mit der Pflanze, die aus dem Saatkorn wächst: sie ist zwar noch dieselbe, aber nicht mehr die gleiche. Mehr kann dazu weder ein Apostel mit Worten noch ein Maler mit seinen Pinselstrichen sagen. Auferstehung – ein Wachsen in der Natur – ein flatterndes Tuch – eine große Hoffnung.
Dienstag, 18. April 2017
Ostern! „Der Herr ist auferstanden.“ Das Leben siegt über den Tod. Das Licht bezwingt die Dunkelheit. Weit mehr noch als Worte breiten Lieder die Osterfreude aus: „Nun singt dem Herrn das neue Lied, in aller Welt ist Freud und Fried. Es freu sich, wer sich freuen kann, denn Wunder hat der Herr getan.“
„Ich kann keine Freude spüren,“ sagt die Frau beim Hausbesuch, deren einzige Tochter vor drei Wochen an Krebs gestorben ist. „In mir ist immer noch Karfreitag.“ Und dass sie jetzt oft denkt, ob es denen auch so geht, die kürzlich einen geliebten Menschen verloren haben bei den Anschlägen in London und voriges Jahr in Berlin. Wann wird es für sie wieder Ostern?
„In aller Welt ist Freud und Fried?“ Was wir erleben, sieht anders aus. Syrische Städte werden zu Trümmerlandschaften gebombt, Ostafrikas Äcker verdorren in glühender Hitze, in trostlosen Flüchtlingscamps geht eine junge Generation zugrunde. Das Leiden in dieser Welt hört nicht auf.
So ist es heute, und auch damals war es nicht anders, als die ersten Christengemeinden die freudige Nachricht von der Auferstehung des gekreuzigten Jesus ausbreiteten. Überall im Land gab es heimtückische Attentate von Untergrundkämpfern gegen die Besatzungsmacht und deren gnadenlose Reaktion. Viele Freunde waren in Gefängnissen verschwunden oder öffentlich hingerichtet worden. Und doch kamen sie von diesem Jesus aus Nazareth nicht los. Wenn sie von ihm sprachen, ahnten sie, wie die Welt wirklich sein sollte. Ein guter Ort zum Leben mit Platz für alle und nicht ein Schauplatz für Krieg und Zerstörung. Die Maßstäbe einer Gesellschaft, die sich nur an Macht und Reichtum orientiert, hatten diesen Jesus nie interessiert. Er hatte nichts zu verlieren. Deswegen konnte ihn auch niemand unter Druck setzen. Der Tod war für ihn nicht das Ende des Lebens, sondern eine Welt ohne Güte und ohne Gott. Auch das entsprach ganz und gar nicht den üblichen Maßstäben. Ein Leben nicht von dieser Welt. Und darum aus ihr nicht zu vertreiben. In Jesu Nähe spürte man ewiges Leben bei lebendigem Leib.
Nach dem Anschlag in London schrieb jemand an die Wand einer U-Bahn-Station: „Schlimme Dinge passieren in der Welt. Aber aus diesen Situationen erwachsen immer Geschichten von gewöhnlichen Menschen, die außergewöhnliche Dinge tun.“ So ist auch die Nachricht von Ostern in die Welt gekommen.
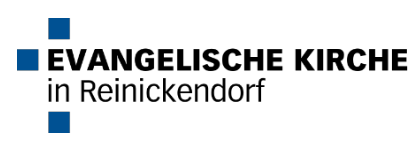

Kommentare